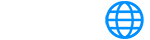Uni-Projekt Wie die Römer über die Donau
Stand: 30.09.2025 14:17 Uhr
Wie konnten die Römer einst ihr Reich an den Flüssen verteidigen? Um dem nachzugehen, hat ein Team der Universität Erlangen-Nürnberg deren Schiffe nachgebaut – und will damit auf Reise gehen.
Die Grenze des Römischen Reiches verlief einst über weite Strecken an Flüssen entlang. Wie konnten die Römer sie verteidigen? Wie haben sie ihre Boote genau gebaut? Und was waren deren Vorteile gegenüber anderen Schiffen? Diese und weitere Fragen will ein Team um Boris Dreyer, Professor für Alte Geschichte an der Universität Erlangen-Nürnberg, beantworten.
Studierende und er bauen dazu Boote aus der Römerzeit nach und testen sie auf Herz und Nieren. Jetzt ist ein weiteres Boot dazu gekommen – ganz ohne Baupläne aus der Antike gebaut.
Die „Alchmona rediviva“ bei ihrer Testfahrt auf dem Altmühlsee.
Römerboot-Taufe mit griechischem Wein
„Alchmona rediviva“, so heißt das neueste Schiff des Teams von Boris Dreyer. Ende September wurde es am Altmühlsee bei Gunzenhausen zum ersten Mal zu Wasser gelassen. Die Aufregung beim Team war groß: Passt alles, schwimmt das Boot auch?
Das circa elf Meter lange Schiff wurde innerhalb von einem Jahr von Studenten und Freiwilligen gebaut, erzählt Boris Dreyer stolz. Die kleine Fähre, auch Prahm genannt, besteht komplett aus Eichenholz. Astgabeln an beiden Seiten stützen die Seitenwände, 600 Eisennägel wurden verbaut. Etwa drei Tonnen, schätzt Dreyer, wiegt das dritte Boot, das er mit seinem Team seit 2016 gebaut hat.
Dass das Team auch Humor hat, beweist der Wein, der zur Schiffstaufe verwendet wird: „Greek Wein“ steht auf der Flasche. „Ob die Römer das zugelassen hätten?“, fragt Boris Dreyer schmunzelnd. Fakt ist, das Boot schwimmt und das Team ist zufrieden.
Das Schiff besteht aus Eichenholz. Die Römer hätten damit ideal Material wie Getreide auf kleineren Flüssen transportieren können.
Transport im flachen Gewässer
Die „Alchmona rediviva“ ist ein besonderes Schiff, weil sie sich gut für den Transport von Gütern auf kleineren Flüssen wie der Altmühl geeignet hätte, sagt Dreyer. Der Rumpf ist flach und hat keinen Kiel. Der Bug und das Heck ähneln einer Rampe.
Mit einem Tiefgang von maximal 15 Zentimetern konnten die Römer damals auf kleineren Flüssen wie der Altmühl ihre Stützpunkte mit Material wie Getreide und Kriegsgerät beliefern – ein wichtiger Vorteil, um die Grenzen zu verteidigen. Solche kleinen Fähren gab es damals in unterschiedlichen Größen.
Nachbau eine große Herausforderung
Der Bau von Booten aus der Römerzeit ist eine große Herausforderung, denn konkrete Baupläne gibt es keine aus dieser Zeit, sagt Dreyer. Wenn Handwerker etwas Gutes gebaut hatten, legten sie großen Wert darauf, dass niemand sie so einfach kopieren konnte.
Deshalb müssen sich Dreyer und sein Team auf archäologische Funde verlassen. Genauso war es bei der „Alchmona redivia“. Ein Fund im niederländischen Zwammerdam am Niederrhein bildete die Grundlage für den Nachbau. Einige Abschnitte mussten beim Bau aber improvisiert werden.
Mehr als drei Jahre auf Reisen
Ähnlich war es bei beiden vorher gebauten Römerbooten, der „Danuvina alacris“ und der „Fridericiana Alexandria Navis“. Auch hier gab es keine Baupläne. Mit der „Fridericiana“, dem ersten Nachbau, fuhr ein Forscherteam die Donau hinunter bis zum Schwarzen Meer.
Auch die „Danuvina“, der zweite Nachbau, ein Ruderboot für circa 20 Menschen, war lange Zeit auf dem Fluss unterwegs. Nach drei Jahren kam sie diese Woche wieder zurück in die Werft am Schlungenhof am Altmühlsee. Das 18 Meter lange und sechs Tonnen schwere, gelb-rot gestrichene Patrouillenschiff war unter anderem auf Forschungsmission unterwegs. Es startete in Ingolstadt und fuhr bis nach Südungarn. Jetzt muss es den Winter über in der Werft repariert werden. Algen müssen abgekratzt, die Farbe erneuert und der Rumpf abgedichtet werden, erklärt Dreyer.
Leidenschaft, Teamspirit und Spaß
Es ist eine eingeschworene Truppe, die zusammen mit dem Geschichtsprofessor die römischen Schiffe nachbaut. Studierende, Mitarbeitende der Universität Erlangen-Nürnberg, Bootsbauer: Alle eint die Leidenschaft, Schiffe aus ferner Vergangenheit zu konstruieren und zu testen.
Neben Forschungsfahrten finden immer wieder auch Ausflüge auf den Booten für Touristen statt. Jetzt wartet auf das Team um Dreyer wieder viel Arbeit, damit die „Danuvina alacris“ im April 2026 wieder auf Reisen auf der Donau unterwegs sein kann.