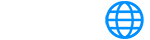Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein“, dichtete der Liedermacher Reinhard Mey im Jahr 1974. Mit seinem Lied über Unbeschwertheit und das Vergessen von Alltagssorgen sind Generationen groß geworden – und erinnern sich daran.
Doch wie ist das in unserer Gegenwart, in der vergangene Kompositionen, Bilder und Liedzeilen in Maschinen eingespeist werden? Entsteht durch diesen Prozess und die Ausgabe an die Nutzer von Künstlicher Intelligenz (KI) wie ChatGPT etwas völlig Neues, und geraten Künstler wie Mey, Kristina Bach (Autorin von „Atemlos“) oder Rolf Zuckowski ins Vergessen?
Es braucht Einordnung
Im Gegensatz zu anderen Klagen streitet die GEMA vordergründig gar nicht darum, ob Liedtexte zum Training von ChatGPT verwendet wurden, das mittlerweile für viele zum Helfer in Alltagsfragen geworden ist. Vielmehr geht es um eine rechtliche Einordnung dessen, was Open AI als grenzenlose Freiheit empfindet, ohne aus der Nutzung der Daten Konsequenzen für sich abzuleiten.
Es war klar, dass im Münchner Prozess zwischen der Verwertungsgesellschaft und Open AI konträre Sichtweisen aufeinanderprallen würden. In Amerika spricht man von historischen Chancen und rasanten Entwicklungen, die von einem schier unerschöpflichen Kapitalzufluss und durch die „Fair Use“-Doktrin getragen werden, die Unternehmen wie OpenAI viel Spielraum geben.
Aus dieser Perspektive ist Europa ein Ausbremser und Verhinderer von Chancen. Gesetzgeber und Justiz schützen hier die Rechte von Urhebern – und das macht jede Form einer Verständigung eben langsamer. Das gilt sogar im Fall der GEMA, die nicht nur selbst KI-Tools einsetzt, sondern im Interesse ihrer Mitglieder gerne möglichst zeitnah ein Lizenzierungssystem umsetzen will. Damit könnte zumindest die finanzielle Teilhabe von Textern gewährleistet werden.
Klarheit durch Gesetzgeber
Es ist richtig, dass sich deutsche Gerichte in dieser Gemengelage ihrer Verantwortung stellen. In der Frage, wie sich Europa im Urheberrecht in einem kompetitiven Marktumfeld positioniert, braucht es jetzt jedoch Ansagen aus Brüssel und Berlin.
Den amerikanischen KI-Firmen wird eine Lösung durch staatliche Gerichte und den Europäischen Gerichtshof jedenfalls viel zu lange dauern. Sie stehen im globalen Wettbewerb mit der Konkurrenz aus Asien. Und Lösungen, die heute für sie tragfähig sind, könnten schon morgen ein Klotz am Bein sein.